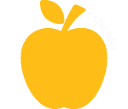

Gefährungsgrad
gefährdet
Regionalsorte
nein
Reifezeit
Die Früchte der Roten Sternrenette reifen am Baum etwa Ende September, oft etwas folgernd. Auf dem Lager halten die Früchte bis November/Dezember und sollten spätestens bis Weihnachten verbraucht sein.
Herkunft
Die Rote Sternrenette ist den historischen Quellen zufolge belgischer Herkunft und war in den ostbelgischen Provinzen Lüttich und Limburg vor 1800 bekannt, von wo aus sie sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch nach Holland und Nordfrankreich verbreitete.
Verbreitung
In Deutschland erlangte die Rote Sternrenette erst in den 1860er Jahren größere Bekanntheit und verbreitete sich anschließend sehr schnell in vielen Regionen und auch in anderen Ländern Europas. Am Niederrhein gehörte die Rote Sternrenette um 1900 bereits zu den Hauptsorten im Anbau. Aufgrund ihres aufstrebenden Wuchses wurde sie häufig auch an Straßen und Feldwegen gepflanzt.
Als klassischer „Weihnachtsapfel“ noch vielerorts bekannt und beliebt, ist die Rote Sternrenette auch heute in vielen Regionen Deutschlands in Streuobstbeständen noch mehr oder weniger häufig zu finden.
Als klassischer „Weihnachtsapfel“ noch vielerorts bekannt und beliebt, ist die Rote Sternrenette auch heute in vielen Regionen Deutschlands in Streuobstbeständen noch mehr oder weniger häufig zu finden.
Frucht
Frucht knapp mittelgroß, rundlich bis abgerundet kegelförmig, ebenmäßig, ohne Kanten; im Querschnitt rund, wie gedrechselt. Fest, wenig druckempfindlich. Schale glatt, mattglänzend, trocken. Grundfarbe bei Pflückreife fahl grün, später weißlich-gelb. Deckfarbe oft über die gesamte Frucht dunkel- bis purpurrot (Schattenfrüchte rosarot), flächig, (z. T. auch etwas verwaschen streifig), baumfrisch teilweise leicht bläulich bereift, von zahlreichen auffallenden Roststernchen oder -dreiecken unterbrochen.
Kelchgrube mittelweit, flach bis mitteltief, schüsselförmig, z. T. mit feinen Falten. Kelchumgebung flach, ebenmäßig. Kelch mittelgroß, halboffen bis geschlossen, mit schmalen feinen Blättchen.
Stielgrube eng, mitteltief, graubraun strahlig berostet, ebenmäßig. Stiel mittellang, mitteldick, meist knapp aus der Stielgrube herausragend.
Kelchhöhle klein, trichterförmig. Kernhaus klein, mit meist geschlossener Achse. Kernhauswände muschelförmig, glatt oder schwach gerissen. Kerne gut entwickelt, relativ dick, rundlich, schwarzbraun, 7-8 : 5-6 mm.
Fleisch gelblich-weiß, fast weiß, fest, oft rötlich geadert (an den Begrenzungslinien ums Kernhaus), oder unter der Schale gerötet (stark besonnte Früchte z. T. auch kräftig rötlich durchfärbt), nur mäßig saftig, aromatisch, sortentypisch würzig.
Kelchgrube mittelweit, flach bis mitteltief, schüsselförmig, z. T. mit feinen Falten. Kelchumgebung flach, ebenmäßig. Kelch mittelgroß, halboffen bis geschlossen, mit schmalen feinen Blättchen.
Stielgrube eng, mitteltief, graubraun strahlig berostet, ebenmäßig. Stiel mittellang, mitteldick, meist knapp aus der Stielgrube herausragend.
Kelchhöhle klein, trichterförmig. Kernhaus klein, mit meist geschlossener Achse. Kernhauswände muschelförmig, glatt oder schwach gerissen. Kerne gut entwickelt, relativ dick, rundlich, schwarzbraun, 7-8 : 5-6 mm.
Fleisch gelblich-weiß, fast weiß, fest, oft rötlich geadert (an den Begrenzungslinien ums Kernhaus), oder unter der Schale gerötet (stark besonnte Früchte z. T. auch kräftig rötlich durchfärbt), nur mäßig saftig, aromatisch, sortentypisch würzig.
Baum
Ältere Bäume der Roten Sternrenette fallen durch ihre großen, gesunden Baumkronen und durch ihre hellen, im Vergleich zu anderen Apfelsorten glattrindigen Stämme auf. Die starken Leitäste stehen typisch im 45°-Winkel zum Stamm – oder ein wenig steiler – und sind oft im Inneren der Krone etwas verkahlt, während die dünntriebige Seitenverzweigung in den Außenbereichen der Krone etwas verdichtet und typisch herabhängend erscheint.
Als junger Baum wächst die Rote Sternrenette in den ersten Jahren oft nur zögerlich und sollte einem straffen Schnitt unterworfen werden. Die Leitäste verzweigen z. T. steil und sind bei der Baumerziehung ggf. flacher zu stellen.
Das Laub ist mittelgroß, meist sehr gesund, glänzend und von mittelgrüner Färbung. Die Blüte im Frühjahr zeitigt spät, ist jedoch etwas empfindlich gegen Witterungseinflüsse. Die einjährigen Triebe sind schlank / dünn und typisch weinrötlich bzw. rötlich braun.
Der Ertrag setzt spät ein, ist dann mittelhoch, alternierend. Als diploide Sorte ist sie Pollenspender für andere spätblühende Sorten.
Als junger Baum wächst die Rote Sternrenette in den ersten Jahren oft nur zögerlich und sollte einem straffen Schnitt unterworfen werden. Die Leitäste verzweigen z. T. steil und sind bei der Baumerziehung ggf. flacher zu stellen.
Das Laub ist mittelgroß, meist sehr gesund, glänzend und von mittelgrüner Färbung. Die Blüte im Frühjahr zeitigt spät, ist jedoch etwas empfindlich gegen Witterungseinflüsse. Die einjährigen Triebe sind schlank / dünn und typisch weinrötlich bzw. rötlich braun.
Der Ertrag setzt spät ein, ist dann mittelhoch, alternierend. Als diploide Sorte ist sie Pollenspender für andere spätblühende Sorten.
Verwechsler
Ähnliche Früchte können haben: Ingrid Marie, Ruhm aus Kelsterbach (Syn. John Standish), Ruhm aus Kirchwerder, Langtons Sondergleichen, Schöner aus Bath, Rote Ananas-Renette (Rheinland), von denen die Rote Sternrenette durch die Reifezeit, die eher kleine und rundliche Frucht, die sternartig berosteten Schalenpunkte, das oft rötlich geaderte Fruchtfleisch, den würzig-aromatischen Geschmack, die breitrundlichen schwarzbraunen Samen sowie anhand der beschriebenen Baummerkmale unterschieden werden kann.
Anbaueignung
Die Sorte ist robust gegenüber Schorf, Mehltau und Obstbaumkrebs und ist daher nicht allzu anspruchsvoll an den Standort. Allerdings braucht sie eher feuchte Böden, während trockene Standorte schlecht vertragen werden. Höhere Lagen sind ebenfalls möglich.
Fruchtfotos
Literatur
Pomologische Monatshefte 1868, S. 2
Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1875): Illustrirtes Handbuch der Obstkunde. Band 8. Äpfel. Ravensburg, Deutschland; Dornsche Buchhandlung. Nr 670.
A. Bivort, Album de Pomologie Bd IV 1851, S.61
Müller, J.; Bißmann, O, Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. 6. Lieferung
Petzold, H. (1982): Apfelsorten. 2. Auflage. Leipzig, Radebeul, Deutschland; Neumann.
Diese Beschreibung ist (in verkürzter Form) Teil des vom Autor 2025/26 erscheinenden Buches „Atlas der Apfelsorten Deutschlands“. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags Quelle & Meyer.
