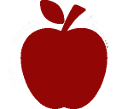

Gefährungsgrad
vom Aussterben bedroht
Regionalsorte
nein
Synonyme
Bürgerherrenapfel, Borgherre, Geflammter Weisser Cardinal, Pleißner Sommer Rambur, Kantorapfel und viele weitere Namen
Reifezeit
Ab Ende September erntereif, von Oktober bis Anfang Dezember essbar.
Herkunft
Die Herkunft dieser Sorte lässt sich heute nicht mehr sicher klären. Schon Diel beschreibt den Apfel um 1800 unter verschiedenen Namen. Wimmer gibt das Jahr mit 1762 an. Oberdieck bezieht sich auf Diel und schreibt, dass die Sorte aus Sachsen stammt. In Skandinavien ist die Sorte unter dem Namen Bürgerherrenapfel (wie ihn Oberdieck beschrieb) verbreitet worden, nach Dahl gibt es davon aber schon lange zwei sehr ähnliche Typen. 1859 wird im ,,Illustrirten Handbuch der Obstkunde, Band 1" unter der Nummer 209 von Schmidt ein Geflammter Weißer Kardinal beschrieben, dieser soll aber ein lagerfähiger Winterapfel sein.
Verbreitung
Kommt selten, aber regelmäßig überall in Deutschland vor. Wird leider aber auch öfter falsch geliefert, da in Sortensammlungen verkehrte Sorten unter dem Namen stehen.
Frucht
Geflammter Kardinal ist eine mittelgroße, sehr unregelmäßig Frucht. Die Variation reicht von kegelförmig bis fassförmig, aber auch abgeplattet kugelig. Der Querschnitt ist stark drei- bis vierkantig. Die tiefe, unrunde Stielgrube ist meist grobschuppig dunkelbraun berostet. Die Kelchgrube ist eng und mitteltief. Durch die Rippen, die bis in die Klechgrube laufen, ist der meist geschlossene Kelch oft unrund geknautscht. Die Schale wird beim Lagern leicht fettig und kann bis zu 3/4 karminrot geflammt sein. Die Lentizellen sind unscheinbar. Das große, weit offene, rissige Kernhaus enthält hauptsächlich schlecht ausgebildete, mittelbraune Kerne mit den Maßen 9 : 4 mm. Das Fruchtfleisch ist cremefarben, saftig und säurebetont.
Baum
Der Baum bildet große ausladende Kronen, die im Alter in die Breite gehen.
Verwechsler
Gravensteiner kann eine ähnliche Form und Farbgebung haben.
Dülmener Herbstrosenapfel, wenn dieser stärker gefärbt ist.
Dülmener Herbstrosenapfel, wenn dieser stärker gefärbt ist.
Anbaueignung
Als reichtragender robuster Wirtschaftsapfel mit historischem Wert ist die Sorte für Streuobstwiesen zu empfehlen.
Fruchtfotos
Triebe
Literatur
Diel, A. F. A. (1801): Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten. Heft 6 (Äpfel 4). Frankfurt a. M., Deutschland; Andreäische Buchhandlung. S. 92
Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1859): Illustrirtes Handbuch der Obstkunde. Band 1. Äpfel. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 181
Lauche, W. (1882): Deutsche Pomologie. Äpfel, 1. Band. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 7
Müller, J.; Bißmann, O, Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 4, Nr. 44
Dahl, C. G.: Pomologi (1943): 1. Teil Äpplen. Stockholm, Schweden; Albert Bonniers. 1943, S. 158
Meyer, J.; Bade, J.; Schuricht, W. (2020): Geisenheimer historische Farbzeichnungen alter Apfelsorten. Hamburg, Deutschland. S 38
Diese Sortenbeschreibung wurde möglich durch eine Spende von:
Oberlausitzstiftung
Oberlausitzstiftung
