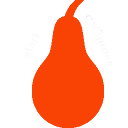


Gefährungsgrad
stark gefährdet
Synonyme
Herrenhäuser Winterchristbirne, Tönninger Birne, Johantorp (SE)
Reifezeit
Pflückreife Mitte Oktober, Genussreife Anfang Dezember bis Ende Januar, aus dem Kühllager bis April.
Herkunft
Der Name lässt vermuten, dass die Sorte aus der Baumschule von Hannover-Herrenhausen stammt. Tatsächlich muss es sich aber um eine ältere Sorte handeln, die Ende des 19. Jahrhunderts so benannt wurde. Der Name Herrenhäuser Christbirne taucht erstmalig 1898 im Verzeichnis der Obstsorten für die Provinz Hannover auf und wird in früheren Verzeichnissen nicht erwähnt. In Schweden ist die Sorte unter dem Namen Johantorp verbreitet. Dahl gibt an, dass sie 1860 aus einer Lübecker Baumschule (wahrscheinlich die von Heinrich Behrens in Travemünde) ohne Namen bezogen wurde. Dies legt den Schluss nahe, dass es sich um eine wesentlich ältere Sorte handelt, deren ursprünglicher Name verloren ging und daher mit dem Namen Herrenhäuser Christbirne belegt wurde. Dafür spricht auch, dass für die sogenannte Tönninger Birne (Schleswig-Holstein), erstmals erwähnt 1897 in der Schleswig-Holsteinischen Zeitung für Obst und Gartenbau 1913, und später auch 1930 festgestellt wurde, dass es sich um die Herrenhäuser Christbirne handelt. Dahl zitiert aus der Zeitschrift der Schwedischen Pomologischen Vereinigung von 1923, dass es sich um die alte französische Sorte Jaminette handeln könnte. Diese Sorte findet sich tatsächlich auch im Katalog der Travemünder Baumschulen von ca. 1860 - ein Vergleich mit den historischen Beschreibungen ist aber nicht eindeutig und bis heute gelang es nicht, Reiser oder Früchte der Jaminette zu erhalten.
Verbreitung
Einstmals für Schleswig-Holstein und Niedersachsen empfohlen wurden Altbäume bis jetzt nur in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gefunden.
Frucht
Die Früchte sind recht variabel, auf Sämlingsunterlage kreiselförmig, auch eiförmig, oft schief oder ungleichhälftig, zum Stiel schwach eingezogen. Der 20-30 mm lange Stiel sitzt in einer kleinen Grube wie eingesteckt, an der Basis häufig mit einem Fleischringel. Typisch ist die berostete, mitteltiefe Kelchgrube mit dem sehr kleinen Kelch, der von sternförmig aufliegenden Blättern, die an der Basis verwachsen sind, umgeben ist. Die Frucht steht gut. Insgesamt wirkt die Frucht düster und schmutzig. Die grünliche Grundfarbe hellt beim Reifen kaum auf. Manchmal bildet sich eine schwache braunrote Deckfarbe aus, meist finden sich auch einzelne Rostfiguren oder Rostnetze. Das Fleisch ist körnig und wird manchmal auch halbschmelzend, es ist weinsäuerlich mit leichter Würze und Süße. Obwohl nicht schmelzend eine gute Wintertafelbirne, außerdem ist sie auch eine gute Kochbirne.
Baum
In der Jugend starkwüchsig, mit Ertragsbeginn nachlassend, wenig anspruchsvoll. Bringt gute Erträge und wurde auch als Massenträger empfohlen. Blüte mittelfrüh, 7 Blüten pro Blütenstand. Blatt mittelgroß, länglich, eiförmig, Blattrand ganzrandig, Basis gerade. Nicht schorfempfindlich, etwas anfällig für Birnengitterrost. Die Sorte ist diploid.
Anbaueignung
Breit anbaufähig, streuobsttauglich, wurde früher auch als Straßenbaum empfohlen. Gut geeignet für die Selbstversorgung auch im Hausgarten. Wäre einen Versuch im Bio-Erwerbsanbau wert.
Fruchtfotos



Triebe

Laub

Literatur
Dahl, C.G.: Pomologi… 2.Band Stockholm 1943 S. 166
Verzeichnius der Obstsorten für die Provinz Hannover 1898
Praktischer Ratgeber im Obst und Gartenbau 1894 S 374
Deutsche Obstbauzeitung 1915 S274
Schleswig-Holsteinische Zeitung für Obst und Gartenbau 1913 S65
Heydemann, 50 Jahre Obstbau in Schleswig-Holstein
