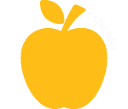

Gefährungsgrad
gefährdet
Regionalsorte
nein
Reifezeit
Pflückreife Anfang Oktober. Sollte dann bald verarbeitet werden (zu Saft, Brand, Viez etc.). Auf dem Lager bis Dezember haltbar.
Herkunft
Der Erbachhofer Weinapfel ist vor 1880 in Erbachhof bei Waiblingen (Baden-Württemberg) entstanden, einem der Epizentren des schwäbischen Obstbaus, in direkter Nachbarschaft der apfelnamensgebenden Ortschaften Bittenfeld, Schwaikheim und Beutelsbach. Anfangs nur in Schwaben verbreitet, wurde die Sorte ab 1925 auch von der großen Obstbaumschule Fey in Meckenheim (Rheinland) als Mostapfel vermehrt und als Ersatz für den schorfanfälligen Roten Trierer Weinapfel angepriesen. Über die Fey’schen Filialen in Merzig (Saar) und Wittlich (Mosel) wurde die Sorte auch stark im Stammland des Roten Trierer Weinapfels verbreitet.
In den Obstsortenbüchern der letzten Jahrzehnte heißt es fälschlich, der Erbachhofer stamme aus dem Sauerland (Westfalen). Diese Angabe, von einem der Autoren in den 1980er Jahren in die Welt gesetzt, wurde leider von allen Buchautoren ungeprüft übernommen. Auch die auf einzelnen Internetseiten kolportierte Aussage, die Sorte stamme aus dem Saarland, ist falsch.
In den Obstsortenbüchern der letzten Jahrzehnte heißt es fälschlich, der Erbachhofer stamme aus dem Sauerland (Westfalen). Diese Angabe, von einem der Autoren in den 1980er Jahren in die Welt gesetzt, wurde leider von allen Buchautoren ungeprüft übernommen. Auch die auf einzelnen Internetseiten kolportierte Aussage, die Sorte stamme aus dem Saarland, ist falsch.
Verbreitung
Im Saarland und an der Mosel – ebenso wie auch im Raum Waiblingen und Stuttgart – ist die Sorte noch heute im Streuobst verbreitet. Darüber hinaus kommt sie auch in anderen Regionen Deutschlands sowie Luxemburgs, Belgiens und Frankreichs gelegentlich vor. Zeitweise wurde sie auch als Spezialmostapfel für den Plantagenanbau empfohlen.
Frucht
Frucht klein, hochbebaut, typisch spitzkegelig, zum Kelch zugespitzt, z.T. glockenförmig, zum Kelch hin öfters schief; im Querschnitt ziemlich rund. Mittelfest, gut transportfähig. Schale glatt, mattglänzend, trocken, relativ fest, hart, beim Verzehr störend. Grundfarbe bei Pflückreife olivgrün, gelblich-grün, spät aufhellend. Deckfarbe dunkelrot, blutrot, bläulich-bräunlich-rot, verwaschen-streifig bis flächig, teils über die ganze Frucht, teils auf zwei Dritteln bis vier Fünfteln der Frucht. Frucht baumfrisch schwach bläulich bereift. Fruchtseiten unberostet. Schalenpunkte klein, hell, wenig auffallend. Kelchgrube flach, eng bis mittelweit, faltig. Umgebung flach, etwas buckelig. Kelch mittelgroß oder klein, variabel halboffen oder geschlossen, Kelchblättchen stark grau befilzt. Stielgrube eng bis mittelweit, mitteltief bis tief, nur gering berostet, Umgebung ebenmäßig. Stiel kurz bis mittellang, dünn, meist nicht oder nur gering aus der Stielgrube herausragend. Kelchhöhle kurz, dreieckig, mit typisch feinem dünnem Stempel, manchmal auch mit einer feinen schmalen, kurzen bis mittellangen Röhre. Kernhaus klein, stielnah, mit schmal bis breit geöffneter Achse. Kernhauswände glänzend, nicht gerissen. Kernhausbegrenzungslinie weitläufig ums Kernhaus verlaufend. Kerne dunkelbraun, gut ausgebildet, aber nicht ganz einheitlich, manchmal etwas verkrüppelt erscheinend, ca. 7-8 : 4 mm. Fruchtfleisch grünlich-weiß, fest, etwas grobzellig, säuerlich, gelagert mäßig saftig, gering aromatisch.
Baum
Der Erbachhofer Weinapfel wächst in der Jugend stark, mit steil aufrechten Seitenästen. Die Bäume kommen früh in den Ertrag und tragen reich, wodurch sich die Äste leicht unter Fruchtbehang nach unten neigen und auf den Astoberseiten wieder neue Triebe bilden. Zur Erzielung stabiler, kompakter Kronen ist daher in den ersten Jahren ein regelmäßiger Erziehungsschnitt erforderlich.
Die Sorte bildet mittelgroße, hochkugelige Kronen, die – um Kleinfrüchtigkeit und Astbruch zu vermeiden – regelmäßig ausgelichtet bzw. zurückgeschnitten werden sollten. Die Blüte zeitigt im Frühjahr mittelfrüh und ist relativ robust gegen Witterungseinflüsse.
Die Sorte bildet mittelgroße, hochkugelige Kronen, die – um Kleinfrüchtigkeit und Astbruch zu vermeiden – regelmäßig ausgelichtet bzw. zurückgeschnitten werden sollten. Die Blüte zeitigt im Frühjahr mittelfrüh und ist relativ robust gegen Witterungseinflüsse.
Verwechsler
Ähnliche Früchte können haben: Nathusius Taubenapfel, Roter Trierer Weinapfel, Wettringer Taubenapfel, Mutterapfel.
Anbaueignung
Bezüglich der Boden- und Standortverhältnisse ist der Erbachhofer breit anbaubar. Nur stark tonige Böden sollten gemieden werden. Gegenüber Schorf und Obstbaumkrebs ist die Sorte relativ robust, lediglich leicht anfällig gegenüber Mehltau.
Fruchtfotos

Baum im Laub
Literatur
Bannier, H.J. 2021, Wo der Erbachhofer wirklich herkommt, in: Schwäbische Heimat 3/21
Bannier, H.J. 2022. Wo der Erbachhofer wirklich herkommt. Über die Unsitte des Abschreibens in der Obstsorten-Literatur, in: Jahresheft 2022 des Pomologen-Vereins e.V. (S. 94 f.)
Katalog Baumschule Fey (Meckenheim), 1938/39 und 1952/53
Bosch, Hans-Thomas, 2006. Rambur, Renette, Rotbirn; Hrsg. Verband der Gartenbauvereine Saarland-Pfalz
Zeitschrift 'Der Obstbau' (Baden-Württemberg), Februarheft 1920
Diese Beschreibung ist (in verkürzter Form) Teil des vom Autor 2025/26 erscheinenden Buches „Atlas der Apfelsorten Deutschlands“. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags Quelle & Meyer.
