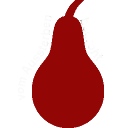

Gefährungsgrad
vom Aussterben bedroht
Synonyme
Beurre Bretonneau, Docteur Bretonneau, Calebasse d`Hiver
Reifezeit
Erntezeit ist Anfang bis Mitte Oktober, zumal die Sorte fest am Baum hängt. Die Lager- und Genussfähigkeit hängt scheinbar stark vom Standort ab, da die Erfahrungen hier abweichen. Sie wird sich irgendwo zwischen Januar und Juni bewegen.
Herkunft
Nach einheitlichen Literaturangaben entstand die Sorte durch eine Kernaussaat von Esperen aus Mecheln in Belgien und trug 1846 erste Früchte. Benannt wurde sie aber erst nach dem Tode von Esperen 1847 nach einem Dr. Bretonneau aus Tours. Bivort war wohl der Erste, der Verwirrungen in den Namen brachte, weil er die Sorte erst unter Beurre Bretonneau beschrieb (was auch A. Leroy tat) und später in den Annales de Pomologie auf Docteur Bretonneau änderte. Von verschiedenen Autoren wird das Synonym Calebasse d`Hiver angegeben, wofür es aber keine Erklärung gibt, da die Frucht der Form nach nicht zu den Flaschenbirnen zählt.
Verbreitung
In Deutschland wahrscheinlich sehr selten, zumal die Sorte als Winterbirne wärmeliebend ist.
Ist im Erhaltungsnetzwerk gesichert.
Ist im Erhaltungsnetzwerk gesichert.
Frucht
Mittelgroße kegelförmige Frucht, die höchstens leicht und nur einseitig eingeschnürt ist, dann auch Rücken bildend, verjüngt sich regelmäßig, rundet sich zum Stiel ab, oder läuft sogar etwas spitz aus, steht und ist im Querschnitt schwach kantig. Die Stielgrube ist nur einseitig oder fehlt ganz bzw. es bildet sich ein Wulst, der den Stiel meist 30 ° schräg stellt, ohne deutliche Berostung. Der Stiel ist braun, dickfleischig, in jedem Fall am Ansatz bis 1,5 cm lang, bis 4 mm dick und am Ende etwas keulig verdickt. Der offene, kurzblättrige Kelch ist klein, in weiter mitteltiefer Grube, meist bis auf den Grubenrand schuppig berostet. Die dicke, feinnarbige Schale hellt in der Grundfarbe erst sehr spät auf, Deckfarbe zeigt sich meist nur als trüber braunroter Hauch, die Lentizellen sind sehr auffällig und gehen zum Kelch hin in Rostnetze über. Die Kernhausachse ist leicht geöffnet mit anliegenden eiförmigen Kammern mit Nase, die gut erhaltene breite Kerne enthalten, 9 : 5,5 mm. Das Fruchtfleisch ist fest, saftig, hauptsächlich süßlich, die weitere Qualität hängt vom Jahresverlauf und dem Standort ab, von fast schmelzend mit leichter Säure, nicht schlecht, bis in schlechten Jahren eher nur Kochbirnenqualität.
Baum
Doktor Bretonneau wächst stark und verzweigt sich gut. Das Laub ist länglich, gesund und scheint nur etwas für Sonnenbrand und Weißfleckenkrankheit anfällig zu sein. Die Blüte erscheint mittelspät mit 8 einzelnen Blüten pro Knospe.
Verwechsler
Arenbergs Butterbirne, ist aber kleiner und nicht so lange lagerfähig.
Anbaueignung
Im Zuge des Klimawandels scheint die Sorte nicht nur in Weinbaulagen eine schmackhafte und lohnende Wintertafelbirne zu sein.
Baum im Laub
Baum in Blüte/Winter
Jungbaum
Rinde
Literatur
Willermoz, C. F.(1863) Pomologie de la France, Lyon, Frankreich. Band 1 Tafel 40
Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1866): Illustrirtes Handbuch der Obstkunde. Band 5. Birnen. Ravensburg, Deutschland; Dornsche Buchhandlung. Nr. 330
Leroy, A. (1867): Dictionnaire de Pomologie. Tome I - Poires. Angers, Frankreich. S. 176
Berghuis, S. (1868): Niederländischer Obstgarten. Vol. 2. Birnen und Steinobst. . Groningen, Niederlande; J. B. Wolters. S. 73
Hogg, R. (1884): The Fruit Manual. Fifth Edition. London, Großbritannien. S. 515
Diese Sortenbeschreibung wurde möglich durch eine Spende von:
Zeitlupe gGmbH
Zeitlupe gGmbH
