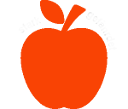


Gefährungsgrad
stark gefährdet
Regionalsorte
nein
Synonyme
Calville blanc d`Hiver
Reifezeit
Anfang bis Mitte Oktober ernetreif, dann ab Dezember bis März genussfähig
Herkunft
Die Sorte soll schon von Jean Bauhin 1598 unter dem Namen Weiß Zürcher Apfel kurz beschrieben worden sein, ob es sich dabei wirklich um den Weißen Winterkalville handelt, lässt sich heute schwer beurteilen, aber der entsprechende Holzschnitt in der deutschen Übersetzung von 1602 zeigt immerhin die Kelchseite eines deutlich gerippten Apfels, so dass eine Identität nicht unmöglich erscheint. Als Calville Blanc wird er erstmals von Le Lectier 1628 aufgeführt. In den meisten Werken wird die Sorte als französischem Ursprungs bezeichnet, dies lässt sich aber wie bei vielen sehr alten Sorten nicht mehr sicher feststellen. Die große Zahl von Synonymen, die Flotow im Illustrirten Handbuch für die verschiedenen Gegenden Deutschlands angibt, deutet auf eine schon 1859 sehr lange und starke Verbreitung hin.
Verbreitung
Als König der Äpfel war er im 19 Jhd. weit verbreitet. Die Sorte fehlte in kaum einer europäischen Pomologie und wurde allgemein angepriesen. Um die Jahrhunderwende hatte sich ein regelrechter Hype entwickelt, aus dem Bozener und Meraner Raum wurden hochwertige Früchte an die Fürstenhöfe Europas exportiert und zu Preisen von 1-1,5 Reichsmark per Stück abgesetzt. Mit diesen Importen versuchten dann auch deutsche Obstbauern zu konkurrieren, in den Fachzeitschriften finden sich regelmäßig Artikel wie: "Meine Weißen Winterkalville" , "Erfahrungen mit dem Weißen Winterkalville" etc. Es wurde teilweise ein enormer Aufwand getrieben, bis hin zum Errichten von Mauern für die Spaliererziehung oder zum Eintüten der Früchte. Aufgrund der hohen Ansprüche und der geringen Ernten wirklich hochwertiger Früchte, ging der Anbau ab den 1920er Jahren stark zurück. Heute findest sich die Sorte nur noch bei Liebhabern und in Sammlungen.
Frucht
Mittelgroß bis groß, flachkegelig bis kegelförmig, unregelmäßig stark rippig. Kelchgrube mittelweit, mitteltief, von fünf Höckern umgeben, dazwischen Falten. Stielgrube variabel, meist mittelweit, mitteltief bis tief, strahlig graubraun berostet, Stiel kurz, meist nicht hervorstehend, grünlich. Schale trocken, gelblichgrün, DF schwach verwaschen orangerot. Lentizellen groß, in DF rot umhöft. Achse fast geschlossen, Kammern ohrenförmig, Kerne gut ausgebildet, 8,5:5 mm. Kelchhöhle tief, teils mit breiter Röhre verlängert. Fleisch saftig ausgewogen in Zucker und Säure, wenn ausgereift aromatisch, köstlich.
Baum
Der in der Jugend kräftige Wuchs lässt bald nach. Die Sorte fängt früh und regelmäßig an zu tragen, daraus ergibt sich der hohe Anspruch an einen gut genährten Boden. Sie blüht mittelfrüh. Leider ist die Sorte stark schorfanfällig.
Verwechsler
Es gibt einige gelbe Sorten, die zumindestens kantig sein können: Signe Tillish, Landsberger Renette, Boiken, diese sind aber nie so rippig wie der Weiße Winterkalvill. Ein wirklicher Verechsler ist der Uelzener Kalvill, dieser erscheint aber grüner, hängt typisch lange am Baum und hat eine offene, oft verpilzte Achsenhöhle, eine Kelchröhre kommt vor.
Anbaueignung
In der historischen Literatur wird allgemein angegeben, dass die Sorte nur für das Spalier geeignet ist und die Früchte auf Halb- und Hochstämmen und selbst auf Büschen nicht gut ausgebildet werden. Eigene Erfahrungen zeigen, dass die Früchte im windigen Mecklenburg bei offener Lage, durchaus fast ohne Schorf ausreifen können. Derartige Versuche haben aber sicher nur in windoffenen Lagen Sinn. Die durch die Klimaerwärmung steigenden Temperaturen dürften dem Weißen Winterkalville grundsätzlich entgegen kommen, die hohen Ansprüche an den Boden und die Schorfempfindlichkeit bleiben aber bestehen. Es ist nur eine Sorte für den Liebhaber.
Fruchtfotos





Literatur
Bauhin, J.. (1602): Ein New Bad Buch Stuttgart. ( Übersetzung von D. Förter) S. 86
Le Lectier,P.(1628): Catalogue des arbres cultivez dans son verger et plan. 1628 S. 23
Diel, A. F. A. (1800): Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten. Heft 2 (Äpfel 2). Frankfurt a. M., Deutschland; Andreäische Buchhandlung. S.12
Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1859): Illustrirtes Handbuch der Obstkunde. Band 1. Äpfel. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 1
Leroy, A. (1873): Dictionnaire de Pomologie. Tome III - Pommes. Paris, Frankreich. Nr.82
Müller, J., Bißmann, O., Poenicke, W., Schindler, O., Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 3, Nr. 25
Silbereisen, R.; Götz, G.; Hartmann, W. (1996): Obstsorten-Atlas. 2. Auflage. Stuttgart, Deutschland; Ulmer. S. 160
Diese Sortenbeschreibung wurde möglich durch eine Spende von:
Oberlausitzstiftung
Oberlausitzstiftung
