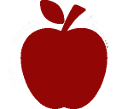


Gefährungsgrad
vom Aussterben bedroht
Regionalsorte
nein
Synonyme
Calville rouge d`Hiver, Calville di Sanguinole
Reifezeit
November
Herkunft
Die Sorte stammt wahrscheinlich aus Frankreich, eventuell aus der Bretagne - wirklich sicher kann man da aber nicht sein, weil frühe Autoren die Sorte gerne mit dem Roten Herbstkalvill und anderen roten Kalvillen verwechselt haben. Nach Leroy hat ihn Le Lectier 1628 als erster aufgeführt, die Sorte wird dann bei vielen französischen Autoren erwähnt (Merlet, Saint Etienne, Duhamel und weiteren). In Deutschland wurde er zuerst 1797 von Sickler abgebildet und beschrieben.
Verbreitung
Der Rote Winterkalvill taucht zwar in vielen älteren Pomologien auf, hat sich aber in Deutschland nicht besonders verbreitet. Flotow gibt im ,,Illustrirten Handbuch" an, dass die Sorte schwer echt zu bekommen sei und sich noch nicht weiter verbreitet hat. Im 20. Jahrhundert taucht die Sorte kaum mehr auf. Bei den in den letzten 25 Jahren unter diesem Namen in den Handel gekommenen Bäumen handelt es sich durchweg um den Roten Osterkalvill. Der Fehler lag im Reisermuttergarten Bonn, der die Edelreiser an Baumschulen abgab, er ist aber inzwischen behoben. Heute gibt es lediglich noch eine einzige Akzession in der Deutschen Genbank Obst.
Frucht
Kegel- bis hochkegelförmig, unregelmäßig kantig bis fast rippig. Stielgrube tief, mittelweit, Stiel dünn, rötlich. Kelchgrube flach, von leichten Wülsten umgeben, mit Fleischperlen. Kelch geschlossen bis offen, Blättchen kaum befilzt. Grundfarbe gelblich, Deckfarbe flächig, teils auch leicht streifig, dunkelrot. Lentizellen kaum eingesenkt. Kelchhöhle trichterförmig mit langer Röhre, Achse geschlossen, Kammern bogenförmig, stark gerissen und etwas ausgeblüht. Kerne variabel von 9 : 4,5 mm bis 10 : 4,5 mm. Fleisch süß.
Baum
Flotow gibt an, dass der Baum eher schwach wächst und etwas zärtlich sei.
Verwechsler
Roter Herbstkalvill reift im September/Oktober, wird stark fettig.
Roter Osterkalvill reift später und hat keine Kelchröhre.
Roter Osterkalvill reift später und hat keine Kelchröhre.
Anbaueignung
Nur für Liebhaber und Sortensammler.
Fruchtfotos




Literatur
Sickler, J. V. ( 1797): Der Teutsche Obstgärtner oder gemeinnütziges Magazin in Deutschlands sämtlichen Kreisen. Band 8. Weimar S. 95.
Diel, A. F. A. (1800): Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten. Heft 5 (Äpfel 3). Frankfurt a. M., Deutschland; Andreäische Buchhandlung. S.1
Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1859): Illustrirtes Handbuch der Obstkunde. Band 1. Äpfel. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 7
Leroy, A. (1867): Dictionnaire de Pomologie. Tome I - Poires. Angers, Frankreich. S.192
Anonym (1935-1956): Nach der Arbeit. Ill. Wochenzeitung f. Garten, Siedlung, Kleintierhaltung. Äpfel. Wien, Österreich. Beilage Tafel 367
Diese Sortenbeschreibung wurde möglich durch eine Spende von:
Oberlausitzstiftung
Oberlausitzstiftung
