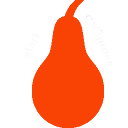


Gefährungsgrad
stark gefährdet
Synonyme
Grev Moltke, Greve A. W. Moltke, Roi Christian
Reifezeit
Ab Mitte September reif, bis Ende Oktober genussfähig.
Herkunft
Um 1850 wurde der Mutterbaum in Turebyholm südlich von Kopenhagen in Dänemark gefunden. Ob dieser ein Zufallssämling war oder ein veredelter Baum, geht aus der Überlieferung nicht hervor. Benannt wurde die Sorte nach dem Grafen Moltke aus Bregentved. Oberdiecks Angaben über die Entstehung des Baumes lassen sich anhand der dänischen Erstbeschreibungen nicht wirklich nachvollziehen, wahrscheinlich gab es einen Übersetzungsfehler. Die Baumschule Freres in Frankreich versuchte die Sorte schon 1887 unter dem neuen Namen Roi Christian neu zu vermarkten.
Verbreitung
Graf Moltke kommt hauptsächlich in Norddeutschland vor, bedingt durch die Entstehung in Dänemark. Da die Sorte an das nordeuropäische Klima angepasst ist, findet sich die Frucht im gesamtem südlichen Teil Skandinaviens wieder. In Sammlungen wird die Sorte bundesweit erhalten.
Frucht
Mittelgroße, birnen- bis kegelförmige Frucht, verjüngt sich spät, meist nur einseitig eingeschnürt, kelchbauchig, steht. Der Querschnitt ist schwach kantig. Zum Stiel leicht abgeplattet, auf kleiner Spitze, die Grube ist etwas eingesenkt mit schwachen Resthöckern. Der Stiel ist bis 2,5 cm lang, bis 4 mm dick, gerade, graubraun. Die Kelchgrube ist mitteltief, eng, unrund, wodurch der Kelch meist geknautscht ist. Dieser ist halboffen, hornig, hochstehend, im Grund verwachsen. Die Schale fühlt sich durch die flächige die gesamte Frucht überziehende braune Berostung rau an. Grund- und Deckfarbe schimmern höchstens durch. Die Lentizellen sind klein und zahlreich. Kernhausachse geschlossen, mit anliegenden Kammern, die schlecht entwickelte Kerne ohne Nase enthalten, Spitze weißlich bleibend, 10 : 5 mm. Das Fruchtfleisch ist cremefarben, halbschmelzend bis schmelzend, süßlich.
Baum
Graf Moltke wächst stark und bildet weit ausladende, große Bäume. Die Blätter sind dunkelgrün, nur leider anfällig für Sonnenbrand. Die Blüte erscheint mittelspät mit 7 Einzelblüten pro Knospe.
Verwechsler
Gellerts Butterbirne ist viel klobiger, meist einen Rücken bildend, die Berostung ist feiner und die Sorte ist diploid.
Madame Verte ist viel später reif, kleiner, hat deutlichere Schalenpunkte.
Madame Verte ist viel später reif, kleiner, hat deutlichere Schalenpunkte.
Anbaueignung
Für den extensiven Obstbau in Norddeutschland sehr gut geeignete Tafelbirne. Ob sie sich - wegen der Sonnenbrand-Empfindlichkeit - auch weiter südlich lohnt, müssen die nächsten Jahre zeigen. Dann wäre die Sorte auch für Höhenlagen geeignet, da sie nicht sehr viel Wärme braucht zum Ausreifen.
Fruchtfotos


Triebe
Laub
Literatur
Bredstedt, H. C.(1890): Haandboog i dansk Pomologi. 1det Bind- Paerer. Odense. Dänemark; L.C. Dreyer. S. 42
Pedersen, A. (1937): Danmarks Frugtsorter. Kopenhagen, Dänemark. S. 65
Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1879): Illustrirtes Handbuch der Obstkunde. Supplement Birnen. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. Nr. 706
Lauche, W. (1883): Deutsche Pomologie. Birnen, 2. Band. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 80
Dahl, C. G.: Pomologi (1943): 2. Teil Päron och Plommon Stockholm, Schweden; Albert Bonniers. 1943, S. 79
Diese Sortenbeschreibung wurde möglich durch eine Spende von:
Zeitlupe gGmbH
Zeitlupe gGmbH
