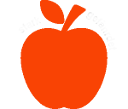


Gefährungsgrad
stark gefährdet
Regionalsorte
ja
Synonyme
fälschlich auch genannt: Klapperapfel, Hasenkopf, Schafsnase
Reifezeit
Die Pflückreife von Hesselmanns Schlotterapfel liegt Anfang bis Mitte Oktober, genussreif ist er von November bis April (Mai).
Herkunft
Den Beschreibungen des Pomologen Theodor Engelbrecht zufolge wurde Hesselmanns Schlotterapfel vom Lehrer und Obstzüchter Carl Hesselmann in Witzhelden (heute Stadt Leichlingen) im Rheinland gezüchtet. Da Engelbrecht die Sorte in ,,Deutschlands Apfelsorten" (1889) beschreibt, muss die Züchtung Hesselmanns einige Jahre zuvor erfolgt sein. Laut Hesselmann selbst wurde der Apfel vom Deutschen Pomologenverein zu Ehren seiner Person Hesselmanns Schlotterapfel genannt (,,Pomologische Monatshefte", 1901).
Verbreitung
Rheinland, heute selten vorkommend. Carl Hesselmann beschreibt 1901 in einem Artikel der ,,Pomologischen Monatshefte" (des Deutschen Pomologenvereins) den Apfel als Lokalsorte des Kreises Solingen. Hier soll er ihm zufolge zu jener Zeit auf vielen Obsthöfen des Bergischen Landes und entlang von Wegen vorgekommen sein. Carl Hesselmann selbst empfiehlt seine Züchtung als ,,prachtvollen Wirtschafts- und Markt- aber auch noch als guten Tafelapfel" [...] wegen ,,seines guten Geschmackes, der Größe, Schönheit und Güte seiner Früchte für die verschiedensten Zwecke". In welchem Maße seiner Anbauempfehlung Folge geleistet wurde, ist nicht bekannt, da bislang kein Altbaum der Sorte aufgefunden werden konnte.
Frucht
Die Frucht ist mittelgroß bis groß und deutlich hochgebaut. Die Form ist variabel walzenförmig oder hochkegelförmig. Einige Früchte weisen eine typische Schafsnasenform auf, andere sind, oft einseitig, zum Kelch hin eingeschnürt oder insgesamt zu einer Seite hin leicht gebogen. Die Grundfarbe des Hesselmanns Schlotterapfel ist grünlich-gelb, später gelb, die Deckfarbe (bis zu 2/3 der Frucht) ist gehaucht rot-orange. Darauf befinden sich leuchtend rote, dünne, kurze bis mittellange Tuschestriche. Die Färbung einzelner Früchte wirkt undefiniert verwaschen/gestreift. Die von undeutlichen Höckern und Wülsten umgebene Kelchgrube ist mitteltief und zumeist relativ eng. Um den geschlossenen oder leicht geöffneten, eher kleinen Kelch befinden sich gelegentlich feine Fleischperlen. Der Stielbereich ist abgeflacht, die Stielgrube dabei eng und mitteltief. Der Stiel ist kurz, dick und knopfig. Die Menge der zimtfarbenen Berostung ist etwas variabel und reicht von wenig bis hin zu mittel / viel. Der feinschuppige Rost ist kurzstrahlig, teilweise von netzartiger Ausprägung und kann auch über der Rand der Stielgrube hinauslaufen, wo er gelegentlich zu Rostfiguren auf einer Fruchtseite übergeht. Beim Schnittbild weist der Hesselmanns Schlotterapfel eine mittelgroße, relativ tiefe, trichterförmige Kelchhöhle auf, die bei rund der Hälfte der Früchte in eine Röhre übergeht. Die Kernhausachse ist weit offen und bildet einen Hohlraum. Auffällig sind die kleinen, runden oder kurz zugespitzten Kerne. Das Fruchtfleisch ist hellgelb, fest und süß-säuerlich. Hesselmanns Schlotterapfel welkt kaum und ist auch im späten Frühjahr noch gut essbar.
Baum
Der Baum des Hesselmannns Schlotterapfel ist relativ starkwüchsig. Da die Äste dünntriebig sind, macht die Krone schon bei jüngeren Bäumen einen insgesamt etwas schleudernden, hängenden Eindruck. Krankheiten und eine erhöhte Anfälligkeit für Schädlinge konnten bislang an Hesselmanns Schlotterapfel nicht beobachtet werden. Er scheint auch mit schweren und schlechten Böden gut zurecht zu kommen. Die Blüte erscheint mittelfrüh, etwa zeitgleich mit Kaiser Wilhelm (Peter Broich). Der Ertrag ist regelmäßig und mittelhoch. Hesselmann selbst beschreibt ihn als sehr reich tragend.
Verwechsler
Stahls Winterprinz, Falsche Rheinische Schafsnase AT, Prinzenapfel.
Anbaueignung
Hesselmanns Schlotterapfel ist eine sehr gesund wachsende, robuste Apfelsorte, die breit anbaufähig und für Streuobstwiesen gut geeignet ist. Durch seine lange Lagerfähigkeit, seine optisch außergewöhnliche Form und wegen der schön gefärbten Früchte ist er nicht nur für Freunde bizarr geformter Früchte interessant. Da Hesselmanns Schlotterapfel sehr lange lagerbar, vielseitig und noch als Tafelapfel zu verwenden ist, dürfte er auch zur Vermarktung geeignet sein.
Fruchtfotos







Baum im Laub

Literatur
Engelbrecht, Theodor 1889: Deutschlands Apfelsorten. Vlg. Vieweg u. Sohn, Braunschweig, Nr.90, S. 100
Pomologische Monatshefte, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 1901: C. Hesselmann: Eine Auslese von 50 Apfel- und 50 Birnensorten für Tafel und Wirtschaft. S. 99
Diese Sortenbeschreibung wurde möglich durch eine Spende von:
Bergischer Streuobstwiesenverein e. V.
Bergischer Streuobstwiesenverein e. V.
