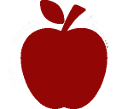


Gefährungsgrad
vom Aussterben bedroht
Regionalsorte
nein
Synonyme
Glace d`Ete, Astracanischer Sommerapfel, Russischer Eisapfel, Hvid Astrakan
Reifezeit
Ende Juli bis Mitte August, nur kurz genussfähig.
Herkunft
Es handelt sich um eine sehr alte Sorte, deren Herkunft unklar ist. In Deutschland beschrieb sie zuerst Christ. Er gab an, dass er sie aus den Kurlanden erhalten hatte und dass sie dort in Russland viel angebaut wurde. Leroy wiederum schreibt, dass Lindley die Sorte 1816 nach England eingeführt hat, um dann zu ergänzen, dass sie in Frankreich bereits 1653 von Bonnefond als Pomme de Glace erwähnt wurde. Dahl nimmt anderseits an, dass es sich um eine schwedische Sorte handelt. Im 18. Jahrhundert seien in Schweden verschiedene Astrachans angebaut worden und er vermutet, dass die Sorte eventuell aus Kernen eines russischen Apfels entstanden sei.
Verbreitung
Nach Lauche war die Sorte in einigen Gegenden Deutschlands sehr verbreitet, 1874 wurde sie zum allgemeinen Anbau empfohlen, im 20. Jahrhundert hat die Sorte keine Bedeutung mehr gehabt und heute ist sie äußerst selten. In Sortensammlungen wird der Weißer Astrachan noch erhalten.
Frucht
Die kleine, kugelförmige bis leicht kegelige Frucht ist im Querschnitt rund bis schwach kantig. Der geschlossene Kelch liegt in einer mittelweiten und mitteltiefen Kelchgrube, die von einigen leichten Wülsten umgeben ist. Stielgrube eng bis mittelweit, mitteltief mit leicht strahligem Rostklecks, der auch leicht schuppig oder ringförmig ausgebildet sein kann. Stiel kurz, oft knopfig. Grundfarbe gelblich, sonnenseits mit dünner, gestreifter Deckfarbe. Kelchhöhle typisch groß, lang, becherförmig. Achsenhöhle meist etwas offen, Fächer rucksackförmig, wenige typisch breite Kerne enthaltend 8 : 5,5 mm. Fleisch weißlich, säuerlich, schnell mehlig werdend. Neigt zu Glasigkeit, in der alten Literatur wird dies als zikadierend bezeichnet.
Baum
Nach Lauche soll der Baum stark wachsen und eine breite,kugelförmige Krone bilden, er beginnt früh und regelmäßig zu tragen.
Verwechsler
Arvidsaeble hat meist kaum Deckfarbe, im Fruchtinneren jedoch ähnlich.
Suislepper ist im Querschnitt unregelmäßig, großes offenes Kernhaus mit vielen kleinen schwarzbraunen Kernen 7 : 4 mm.
Suislepper ist im Querschnitt unregelmäßig, großes offenes Kernhaus mit vielen kleinen schwarzbraunen Kernen 7 : 4 mm.
Anbaueignung
Für Streuobst geeignet, reift zwar früh, wird aber von anderen Frühsorten im Geschmack deutlich übertroffen.
Fruchtfotos



Literatur
Christ, J. L. (1804): Handbuch über die Obstbaumzucht und Obstlehre. 3. Auflage. Frankfurt am Main. Deutschland Nr. 40. S. 441
Diel, A. F. A. (1804): Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten. Heft 10 (Äpfel 6). Frankfurt a. M., Deutschland; Andreäische Buchhandlung. S. 77
Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1859): Illustrirtes Handbuch der Obstkunde. Band 1. Äpfel. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 28
Lauche, W. (1882): Deutsche Pomologie. Äpfel, 1. Band. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 2
Leroy, A. (1867): Dictionnaire de Pomologie. Tome I - Poires. Angers, Frankreich. Nr. 19
Dahl, C. G.: Pomologi (1943): 1. Teil Äpplen. Stockholm, Schweden; Albert Bonniers. 1943, S. 26
Näslund, G. K., Sandeberg, Ingrid af, (2009): Svenska äpplen. Sigtuna, Schweden; Kärnhuset.S.486
Diese Sortenbeschreibung wurde möglich durch eine Spende von:
Oberlausitzstiftung
Oberlausitzstiftung
