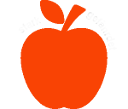

Gefährungsgrad
stark gefährdet
Regionalsorte
ja
Reifezeit
Die Früchte der Zigeunerin sind als Frühapfel zum Frischverzehr, aber auch zur Verarbeitung geeignet. Nach der Ernte – etwa Mitte August – müssen sie alsbald verbraucht werden bzw. sind je nach Lager maximal bis September haltbar.
Herkunft
Über die Herkunft dieser Sorte ist wenig bekannt. Manche Quellen sprechen davon, dass die Sorte in Holland entstanden sein soll. Nach der niederländischen Pomologie „Nederlandse Fruitsoorten“ (1942) stammt die Sorte jedoch ursprünglich aus Riga (Lettland) und wurde von der holländischen Firma Vallen in Swalmen bei Roermond, dicht an der deutschen Grenze, nach Holland eingeführt. „Diese rheinische Sorte mit ihren großen, rötlich gestreiften Früchten, die schon Mitte August reifen, verdient m. E. im übrigen Deutschland Beachtung, schon weil sie ein zuverlässiger Massenträger ist und Früchte von bestechend schöner Farbe bringt; denn vom Früh- und Spätobst kann man bekanntlich nie genug haben“ schreibt ein Leser in der „Rheinischen Monatsschrift für Obst-, Gemüse- und Gartenbau“ (1938, Heft 11). Kritisiert wird andererseits, dass sie Sorte „… für Rohgenuss nicht fein genug (sei)“ (ebd. 1934, Heft 3). In der Wertgruppeneinteilung für Kernobst von 1938 wird die Zigeunerin dennoch in der Preisgruppe 1 genannt (Rheinischen Monatsschrift 1938, Heft 9).
Verbreitung
Die Sorte Zigeunerin hat in den 1920er und 1930er Jahren eine gewisse Rolle im rheinischen Obstanbau gespielt, wo sie als lebhaft gefärbte Frühsorte geschätzt war.
Frucht
Frucht mittelgroß bis groß, hochgebaut, unregelmäßig, leicht kantig, kelchseitig deutlich gerippt. Im Querschnitt unregelmäßig rund bis kantig. Deckfarbe leuchtend dunkelrot, teils deutlich streifig, teils verwaschen-marmoriert, auf zwei Dritteln bis fast der gesamten Frucht. Kelchgrube mitteltief bis tief, eng bis mittelweit. Seiten steil abfallend, deutlich faltig / wulstig, zum Teil mit Fleischperlen, ohne Berostungen. Umgebung mit breit abgerundeten Höckern. Stielgrube eng bis mittelweit, mitteltief bis tief, Berostung fehlend oder gering. Stiel kurz, dünn, meist nicht aus der Stielgrube herausragend.
Baum
Der Baum der Sorte Zigeunerin wächst nur mittelstark bis schwach; er bildet eine eher steil verzweigte, meist kleine Krone. Die Sorte trägt reich und regelmäßig; als diploide Sorte ist sie auch ein Befruchter für andere Apfelsorten. Das Laub ist auffallend groß, oval, mittel- bis dunkelgrün. In erster Linie kommt die Zigeunerin als schön gefärbte und frühreifende Liebhabersorte für kleinere Baumformen in Haus- und Kleingarten in Betracht. Bei einer Veredlung auf Hochstamm benötigt sie aufgrund ihres schwachen Wuchses einen Stammbildner als Zwischenveredlung. Auch sollte man der Sorte eine regelmäßige Schnittpflege angedeihen lassen, um ein vorzeitiges Vergreisen des Baumes zu vermeiden. Fruchtfleisch baumfrisch grünlichweiß bis weißlich, am Kelch bzw. an den Kernhausbegrenzungen vereinzelt rötlich oder violettrot gefärbt bzw. geadert, mittelfein bis etwas grobzellig, locker, mittlerer Saftgehalt, leicht säuerlich, im Aroma mäßig.
Verwechsler
Gravensteiner, Roter Gravensteiner, Jakob Fischer, Mantet, Suislepper, Westfälischer Frühapfel, Herbststreifling
Anbaueignung
Gegenüber Schorf und Mehltau ist die Sorte kaum empfindlich, sie benötigt allerdings einen gut durchlüfteten Boden; auf schweren Böden kann Obstbaumkrebs auftreten.
Baum im Laub

 Mit freundlicher Genehmigung des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) entnommen aus der Veröffentlichung:
Mit freundlicher Genehmigung des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) entnommen aus der Veröffentlichung:„Lokale und regionale Obstsorten im Rheinland - vom Aussterben bedroht!“
Ein Handbuch mit 49 Sortensteckbriefen
Herausgeber: LVR-Netzwerk Umwelt mit den Biologischen Stationen im Rheinland, 2010
Download oder Bestellung unter: lvr.de
