Reifezeit:
Die Pflückreife liegt etwa Anfang bis Mitte Oktober. Genussreif bleiben die Früchte bis etwa Januar. Anfangs fest und „knackend“, werden die Früchte jedoch zum November / Dezember hin mürbe.
Herkunft:
Die genaue Herkunft dieser heute in Teilen des Rheinlands vorkommenden Sorte ist unbekannt. Aus einer Notiz in der „Rheinischen Monatsschrift für Obst-, Garten- und Gemüsebau“ 1915 (Heft 5) geht hervor, dass sie bereits um 1900 aus dem Raum Aachen ins Bergische Land gelangte. Erwähnung findet die Sorte später als „Rotes Seidenhemdchen“ in einer Aufstellung über „rheinische Gebietssorten als Massenträger“ 1943 (Heft 1) in derselben Zeitschrift. Mit dem von den Pomologen SICKLER (1797-1804) und DITTRICH (1839) beschriebenen „Roten Seidenhemdchen“ ist die hier beschriebene Sorte allem Anschein nach nicht identisch, noch weniger mit dem bei KNOOP (1763) und OBERDIECK (1859) beschriebenen aus Holland stammenden „echten“ oder „weißen“ Seidenhemdchen. Da es um die Namensbezeichnungen „Seidenhemdchen“, „Sydenhämchen“, „Apfel aus Sydenham“, „Syden Hemdje“, „Weißes Seidenhemdchen“ und „Rotes Seidenhemdchen“ in der Literatur eine recht große Verwirrung gibt und auch in anderen Regionen jeweils unterschiedliche Sorten als „Seidenhemdchen“ verbreitet sind (so z.B. in der Altmark oder im östlichen Westfalen), soll die hier vorgestellte Sorte unter dem Namen Rheinisches Seidenhemdchen
geführt werden, zumal die Sorte außerhalb des Rheinlandes in Deutschland kaum vorkommt. Auch bei den Baumschulen der Region wird die Sorte unter teils unterschiedlichen Namen verkauft. Die Baumschulen Plum (Heinsberg) und Minis (Herzogenrath) führen die Sorte als „Rotes Seidenhemdchen“, die Baumschule Neuenfels (Königswinter) als „Weißes Seidenhemdchen“, die Baumschule Blume (Langerwehe) hat die Sorte unter dem Namen „Seidenhämchen“ geführt. Die holländische Baumschule Frijns (Margraten) vertreibt ein „Weißes Seidenhemdchen“, bei dem
es sich aber vermutlich um dieselbe Sorte handelt.
Verbreitung:
Ihren Verbreitungsschwerpunkt hat die Sorte heute noch im Raum Aachen, wo sie noch regelmäßig in Obstwiesen und Hausgärten anzutreffen ist. Einzelne Altbäume findet man linksrheinisch auch in den Kreisen Düren, Heinsberg und bis hinab zum Niederrhein sowie auch rechtsrheinisch vom Rhein-Sieg-Kreis über den RheinischBergischen-Kreis bis zum Oberbergischen Kreis. Außerhalb des Rheinlandes scheint die Sorte in Deutschland nur selten vorzukommen. Das Sortenmuseum Doesburg (Holland)
bei Arnheim hat die Sorte ebenfalls in seinem Bestand (unter der irreführenden Bezeichnung „Weißes Seidenhemdchen“). Ob die Sorte in Holland ebenfalls noch verbreitet ist, ist jedoch unklar.
Frucht:
Frucht mittelgroß, typisch kegelförmig, spitzkegelförmig, zum Kelch deutlich verjüngt. Deckfarbe kräftig rot, rosa bis dunkelrot, blutrot, teils bräunlich rot, bei stark gefärbten Früchten flächig verwaschen streifig, bei schwächer gefärbten Früchten marmoriert, streifig, verwaschen-streifig, manchmal mit typischen breiten, schimärenartig abgesetzten Streifen über die gesamte Frucht (Schimärenstreifen auch hell abgesetzt auf dunklerer Deckfarbe). Schalenpunkte klein, berostet oder hell, in den Übergängen von Grund-und Deckfarbe teils auffallend rötlich bzw. teils rötlich oder schattenhaft umhöft. Kelchgrube flach (bis mitteltief), eng bis mittelweit, im Innern öfters typisch deckfarbig rot (selbst bei grundfarbiger Kelchumgebung)Stiel kurz, dünn bis mitteldick, z.T. knopfartig, fleischig, nicht aus der Stielgrube herausragend.
Kernhaus mittelgroß, typisch stielnah, Kernhauswände rucksackförmig, mit einzelnen, z.T. weiß verpilzten Rissen. Frisch vom Baum ist die Sorte auch ein mild süßsäuerlicher Tafelapfel. Heute werden die Früchte des Rheinischen Seidenhemdchens jedoch überwiegend als Mostapfel sowie als Wirtschaftsapfel für die Küche genutzt.
Baum:
Der Baum des Rheinischen Seidenhemdchens ist in der Jugend mittelstark wachsend, dünntriebig, bildet später jedoch große, hochkugelige oder hoch pyramidale Kronen mit steilen Leitästen, dichter feiner Verzweigung und außen überhängenden Fruchtästen. Die Sorte ist reich tragend, jedoch alternierend zwischen hohem und niedrigem (oder aussetzendem) Ertrag. Die Blüte zeitigt im Frühjahr mittelfrüh, das Blatt ist auffallend klein und dunkel- bis etwas graugrün, die jungen Jahrestriebe sind dünn bis mitteldick und von einer hell (rötlich-)grauen Farbe. Kerne gut entwickelt, relativ groß, breit dreieckig gespitzt, ca. 8,5 – 9 mm : 4,5 mm, dunkelbraun, nicht hell auftrocknend. Fruchtfleisch grünlich (gelblich) weiß, fest, mittelfeinzellig bis etwas grobzellig, fest, gering verbräunend, mittlerer Saftgehalt, gelagert später mürbe. Süßsäuerlich, ohne ausgeprägtes Aroma.
Verwechsler:
Gustavs Dauerapfel, Salome, Bäumchesapfel, Geheimrat Breuhahn
Anbaueignung:
Das Rheinische Seidenhemdchen wächst sehr gesund, stellt insgesamt wenig Ansprüche an Standort- und Bodenverhältnisse, ist frosthart und widerstandsfähig gegen Schorf, Mehltau und Obstbaumkrebs. Im Oberbergischen Kreis gedeiht sie auch noch in höheren Lagen bis über 400 m. Insofern ist die Sorte eine typische Wirtschaftssorte für die Obstwiese, die aufgrund ihrer Baumgesundheit, ihres Ertrages und ihrer Fruchtgrößen ihre Erhaltung und Verbreitung verdient. Ihre Früchte sind optisch sehr ansprechend, jedoch eher Wirtschafts- als Tafelapfel.
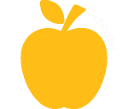 R
R Mit freundlicher Genehmigung des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) entnommen aus der Veröffentlichung:
Mit freundlicher Genehmigung des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) entnommen aus der Veröffentlichung: